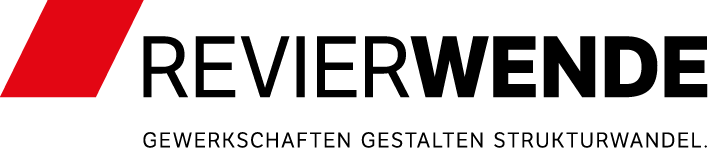Mitteldeutsches Revier
Mit der Braunkohlewirtschaft wurde das Mitteldeutsche Revier zu einem bedeutenden industriellen Zentrum. Schon die zurückliegenden Strukturbrüche führten zu gravierenden Einschnitten. Das Revier weist mit seinen ländlichen Gemeinden im Zusammenspiel mit den großen Ballungszentren Leipzig und Halle sowie zahlreichen renommierten Wissenschaftseinrichtungen große Stärken und Potentiale für die Transformation in eine moderne Industrieregion auf.
Mit großen Entwicklungspotenzialen
Das Mitteldeutsche Revier soll nach der Strukturwandelkommission in Zukunft Teil einer Region sein, die zu den führenden Metropolregionen Mitteleuropas zählt: durch seine Wirtschaftskraft, seine exzellente Bildungslandschaft, seinen kulturellen Reichtum und seine hohe Lebensqualität. Innovative Industrien wie Chemie, Energie, Automotive und Life Science werden in der Region konkrete Antworten auf die großen Zukunftsfragen geben.


Dabei spielt nicht nur die traditionelle Industrie eine wichtige Rolle, sondern auch Startups, kreative Bereiche und aufgewertete soziale Berufe. Viele Akteure aus Bund, Ländern, Kommunen, Unternehmen und Sozialpartnern werden gemeinsam an der Zukunft des Reviers arbeiten und ganz besonders die jungen Menschen vor Ort aktiv einbinden.
Ihre Ansprechpartner*innen für das Mitteldeutsche Revier
Büro Halle (Saale)



Büro Pegau



Kontaktieren Sie uns vor Ort.
Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht oder nutzen Sie den direkten Kontakt zu Ihrem Ansprechpartner vor Ort im Büro Halle (Saale) oder im Büro Pegau.
halle@revierwende.de
Büro Halle (Saale): Röpziger Straße 19 | 06110 Halle (Saale)
pegau@revierwende.de
Büro Pegau: Kirchplatz 3 | 04523 Pegau
Publikationen
Bevor die Kohle geht, muss Neues entstehen. Die Revierwende setzt sich dafür ein, dass die Stimme der Beschäftigten im Strukturwandel gehört wird.